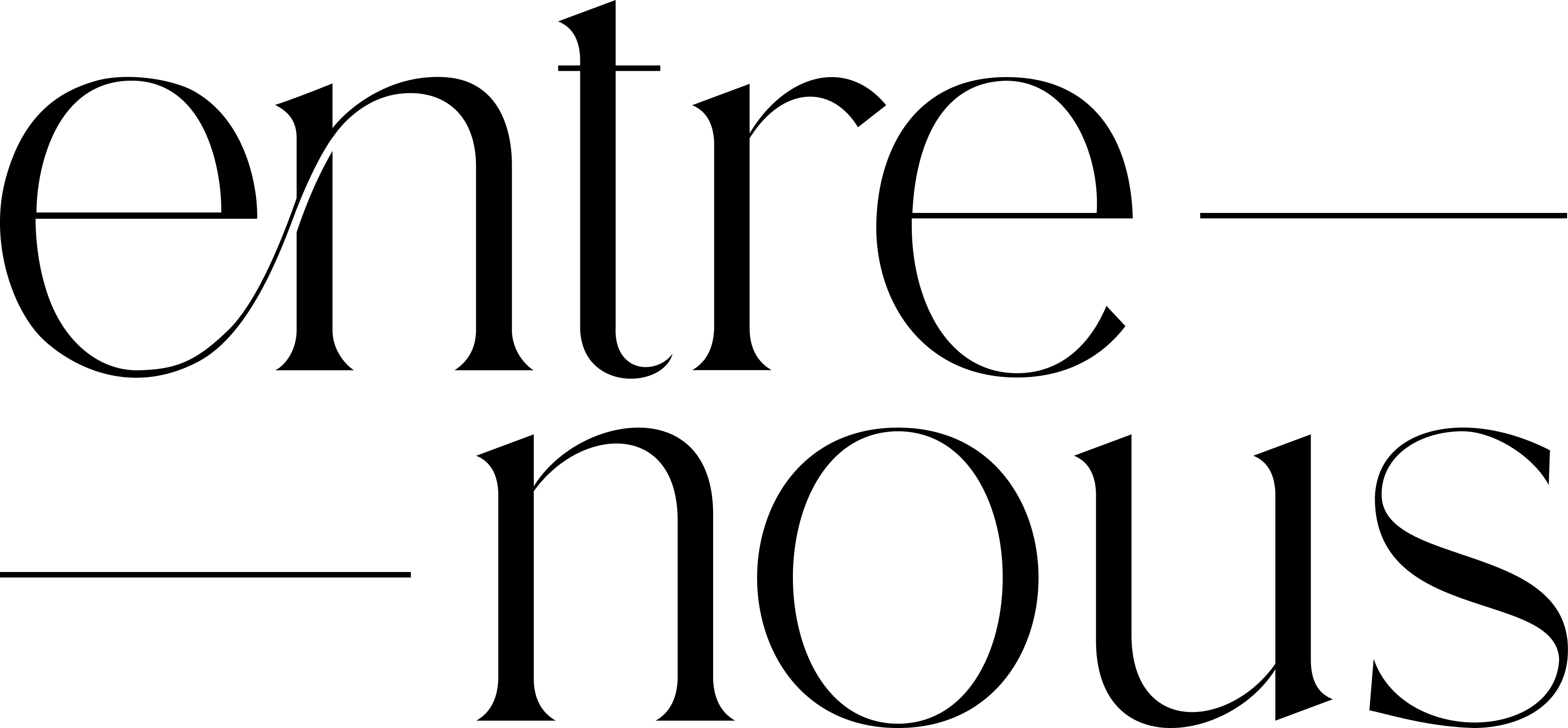Was ist wenn man ewig nach etwas sucht, das man nicht findet? Was ist wenn die endlose Schatzsuche nach der großen Liebe kein Ende hat?
„The Road Less Traveled: A New Psychology of Love, Traditional Values and Spiritual Growth“ ist ein Buch, das von Psychiater M. Scott Peck 2003 geschrieben wurde und diesem Artikel hier mal gleich als Impuls dient.
“While I generally find that great myths are great precisely because they represent and embody great universal truths (and will explore several such myths later in this book), the myth of romantic love is a dreadful lie. Perhaps it is a necessary lie in that it ensures the survival of the species by its encouragement and seeming validation of the falling-in-love experience that traps us into marriage. But as a psychiatrist I weep in my heart almost daily for the ghastly confusion and suffering that this myth fosters. Millions of people waste vast amounts of energy desperately and futilely attempting to make the reality of their lives conform to the unreality of the myth.”
Aber warum rennen wir der romantischen Liebe so nach? Sind es die Medien, die uns einreden, wie man „die perfekte Liebe“ im Leben findet? Daran sind schließlich nicht mehr nur Filme und Serien beteiligt, auch Social Media ist voll mit diesen Inputs. Im starken Kontrast steht dazu allerdings die Dating-Kultur, die für viele (unglückliche) Singles bereits zu einer einzigen Meme-Veranstaltung auf Instagram verkommen ist.
Bevor wir den Mythos der romantischen Liebe angehen – eine Erklärung
Ein historisches Unwissen ist, dass Menschen früher nicht so oft in monogamen Beziehungen gelebt haben, wie wir uns das heute vorstellen. Die Zahl der Kinder, die außerehelich geboren wurden (ob dies der Vater gewusst hat oder nicht sei dahingestellt) war viel höher, als wir durch unsere verklärte „Früher war alles besser“-Brille sehen wollen. Es ist auch daran geschuldet, dass die Ehe für viele (durch materielle Not) einfach keine Option war und ein Ding der Unmöglichkeit. Denn im Gegensatz zu heute, war die Ehe primär ein wirtschaftlicher Bund, der vor allem materiellen Wohlstand und Einfluss in der Gesellschaft absichern sollte.

Wie man beispielsweise an prominenten Beispielen, wie die Geschichte der habsburgischen Prinzessin Marie Antoinette sieht, haben sich Ehepartner:innen – im besten Fall – gemocht, vielleicht sogar geliebt und geachtet, ausschlaggebend war es aber für ihre Eheschließung nicht. So wurde Marie Antoinette dem französischen König Ludwig XVI. versprochen, um die österreichisch-französischen Beziehungen zu verbessern.
Marie Antoinette war sehr um ihren Mann bemüht und unterstützte ihn, wie man heute aus vielen Dokumenten weiß, doch romantisch war sie zeitlebens dem schwedischen Graf Axel von Fersen verbunden. Fersen arrangierte sogar für sie (und ihren Mann!) die Flucht aus Frankreich (die jedoch brachial missglückte).
Wie sehr er sie liebte, zeigte auch ein Brief, den er nach ihrer Hinrichtung schrieb: „Ich habe alles verloren, was ich auf dieser Welt hatte […] Diejenige, die ich so sehr liebte, für die ich tausendmal mein Leben gegeben hätte, ist nicht mehr da.“

Das nur ein kleiner Auszug aus der Geschichte, welche die Einstellung der Gesellschaft gegenüber der Ehe bis vor wenigen Jahrhunderten darstellt. Die Ehe war also – unterm Strich – eine absolut wirtschaftliche Idee, die Frauen und Nachkommen an einen Mann binden, ihnen im Gegenzug aber auch Sicherheit auf unterschiedlichen Ebenen bieten konnte.
Und dann … dann drehte sich vieles. Gesellschaftlich bekam „die Liebe“ einen neuen Twist und eine religiöse Suche nach etwas, das für die wenigsten erfüllbar ist, weil sie eigentlich eine Suche nach uns selbst ist und nicht nach jemandem. Wer also „die erfüllte“ Partnerschaft sucht, könnte einmal diesen Anspruch überdenken. Die Kernaussage des Buches von M. Scott Peck: Sonst wird das nichts.
Warum wir uns so sehr nach romantischer Liebe sehnen
Im 19. und Anfang 20. Jahrhundert wechselte die Wahrnehmung der Ehe in eine romantische Vorstellung. Das leidige Wort „Twin Flames“ oder „Seelenverwandte“ ist nur eines der vielen, die hier früher oder später auftauchen sollten, um eine „ewige“ Bindung an einen Menschen zu verdeutlichen.
Psychiater M. Scott Peck, sieht hier die „Erosionen rund um Religion und Spiritualität sowie eine unsichere Weltordnung“, warum viele die romantische Liebe mystifizieren. Man stopft seine eigenen Hoffnungen (auch jene Vorstellungen von einem Ideal der eigenen Person) in die Illusion einen „perfekten“ Menschen zu finden, der all dem entspricht, was man selbst nicht ist und der einem gleichzeitig Halt geben soll. Eine Anforderung, die unmöglich zu erfüllen ist und – wie eingangs erwähnt – nur zur Katastrophe werden kann.
Die Heilung des „inneren Kindes“, verkorkste Eltern-Beziehungen und eigene Unsicherheiten sind also vorrangig und sitzen „am Steuer der Beziehung“. Eine wahre Höllenfahrt, die nur in Enttäuschung und Missverständnissen enden kann und muss, denn die andere Person bekommt früher oder später automatisch Kratzer im Lack und entblättert sich, sobald man ihr näher kommt.
Ein Sprichwort dazu: „Viele Menschen umarmen nur das, was zwischen ihnen ist.“
Soll heißen: Wir sehen nicht die andere Person, sondern projizieren eine Idealvorstellung auf sie und „umarmen“ diese. Es ist also viel mehr eine metaphysische Berührung, die wir uns wünschen und die sich dann mit dem Kuschelhormon Oxytocin, das wir bei der Berührung ausschütten, in unserem Gehirn manifestieren. Ab diesem Zeitpunkt wird es wirklich schwierig für uns die beiden Ebenen von „was will ich“ und „was ist echt“ auseinander zu halten.

Sätze wie „Wie habe ich das ignorieren können?“ kommen dann erst, wenn alles vorbei ist und der Selbstbetrug der „Liebe“ aufgeflogen ist. Schmerzlich. Aber die Enden von Beziehungen haben mehr mit einem selbst zu tun, als mit dem anderen.
Wenn wir an diesem Punkt kommen, ist es schließlich „der Tod des Egos“, das bereits Sigmund Freud in seiner Tiefenpsychologie angesprochen hat. Auch wenn diesen Zustand nur wenige wirklich spirituell erreichen, ist es doch der „point of no return“, der wichtig ist, um etwas zu ändern. Es ist die Transformationsphase schlechthin.
Die „Anonymen Alkoholiker“ nennen den Zeitpunkt des „rock bottom“. Jener, der innere Klarheit bringt, dass es so nicht mehr weitergehen kann und man den Selbstbetrug aufgeben muss, um sich selbst zu ändern und eine andere Zukunft zu wählen.
Warum hier der Vergleich mit den „Anonymen Alkoholikern“? Ist die Suche nach Liebe für viele nicht auch eine Sucht, die Menschen erst wie Gläser leeren muss, um sich sogleich dem/der nächsten zu widmen? Weil das nächste einfach besser sein muss, als das was jetzt vor uns ist?
Die Idee der romantischen Ehe und warum die Liebe ein Update braucht
Psychiater M. Scott Peck forderte in seinem Buch einen „realistischen Blick“ auf den/die Partner:in UND sich selbst, um darauf eine Beziehung aufbauen zu können, die Kompromisse mit sich und dem/der anderen schließt, akzeptiert und das „Anderssein“ toleriert.
Und jetzt kommt die Schlussfolgerung daraus: Dafür braucht man Zeit, denn die menschlichen Emotionen, die wie ein Feuerwerk in uns abgehen, sind nicht jene, die man braucht, wenn man lange zusammen bleiben, glücklich werden und sich geboren fühlen möchte. Das Dopamin-Feuerwerk der Fantasie, die uns voreilig auf die Reise ins Liebesland schickt, ist jenes, das auch schnell verglüht und uns abstürzen lässt. Es ist das Prickeln der Toxizität, die für viele magnetisch wirkt und damit den Akt der künftigen Selbstverletzung einleitet.

Ein schräger Vergleich (der nichts mit Zwischenmenschlichkeit) aber viel mit Projektion von Gefühlen und Fantasien zu tun hat, ist das Paris-Syndrom.
Dies ist ein psychologisches Phänomen und kulturgebundenes Syndrom, das nahezu ausschließlich bei aus Japan stammenden Besucher:innen auftritt. Als Auslöser gelten das insbesondere in Japan idealisierte Bild von Paris sowie die grundlegenden kulturellen Unterschiede zwischen Japan und Frankreich. Wenn man dann Paris zum ersten Mal sieht, sein ganzes Leben lang darauf gefreut und gespart hat und dann NICHTS so ist, wie es einem Instagram „vorfantasiert“, kommt unweigerlich der Absturz.
Für diesen Fall gibt es mittlerweile sogar Selbsthilfegruppen. Für Liebeskummer sind diese eher selten, wären aber bitte notwendig.
Die Liebe braucht Zeit
Aber wie bekommen wir das alles hin? Wie lernen wir jemanden wirklich kennen? Menschen brauchen Zeit, um sich wirklich kennen zu lernen. Die meisten kennen deswegen ihre Arbeitskolleg:innen besser, als ihre Partner:innen. Oder wie erklärt sich sonst die Tatsache, dass die meisten Scheidungen nach dem gemeinsamen Urlaub eingereicht werden? Die Zeit, wenn man sich mal „aushalten“ muss und nicht nur als WG-Kolleg:innen in der Früh und am Abend sieht?
Man kommt um das nicht rundherum. Das weißt auch M. Scott Peck, der leider 2006 früh verstarb. Es wäre interessant zu hören, was er über die heutige Dating-Kultur zu sagen hätte.
Abonniere unseren EntreNousLetter und bleibe am neuesten Stand. Verpasse keine Updates über Mode, Kunst, Beauty & Lifestyle!